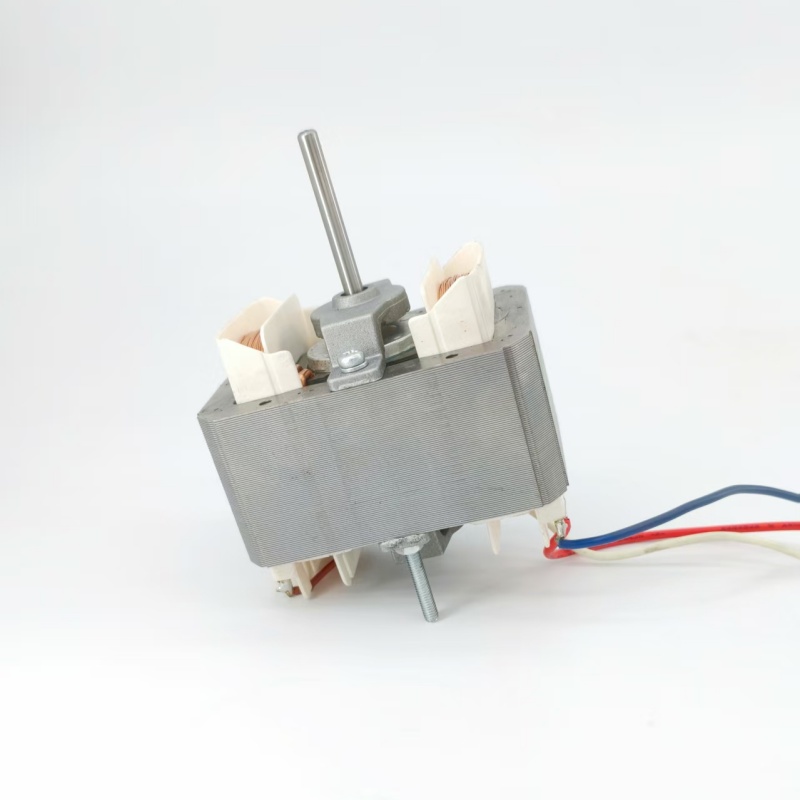In der industriellen Produktion und beim täglichen Stromverbrauch sind die Unterschiede in der Energieeffizienz von Wechselstrommotoren oft erheblich. Beispielsweise verbrauchen einige Motoren beim Betrieb desselben Lüfters 5 kWh Strom pro Stunde, während andere nur 3,5 kWh verbrauchen. Dieser Unterschied ist kein Zufall; er wird durch Schlüsselfaktoren wie die Typenklassifizierung des Motors, seine Konstruktion und seine Anpassungsfähigkeit an die Betriebsbedingungen mitbestimmt. Diese Faktoren wirken sich direkt auf den Grad der Verluste bei der Umwandlung von elektrischer in mechanische Energie aus und führen letztlich zu unterschiedlichen Energieeffizienzniveaus.
Aus Sicht der Motortypen ist der inhärente charakteristische Unterschied zwischen Asynchron- und Synchronmotoren der zentrale Ausgangspunkt für die Lücke bei der Energieeffizienz. Der Rotor eines Asynchronmotors nutzt elektromagnetische Induktion, um Strom für das Drehmoment zu erzeugen. Während dieses Vorgangs wird ein Teil der elektrischen Energie durch „Hystereseverluste“ und „Wirbelstromverluste“ verbraucht. Einfach ausgedrückt: Wenn sich das Magnetfeld des Rotorkerns ändert, werden interne Ströme erzeugt. Diese Ströme sind nicht an der Drehmomentabgabe beteiligt; stattdessen werden sie in Wärme umgewandelt und verschwendet. Insbesondere bei herkömmlichen Asynchronmotoren mit geringer Energieeffizienz besteht der Kern meist aus gewöhnlichen Siliziumstahlblechen, was zu höheren Hystereseverlusten führt. Außerdem ist der Luftspalt zwischen Stator und Rotor (der Luftspalt bezieht sich auf den Abstand zwischen Stator und Rotor) relativ groß, was leicht zu Magnetfeldlecks führt und den Energieverlust weiter erhöht. Der Rotor eines Synchronmotors (z. B. eines Permanentmagnet-Synchronmotors) besteht jedoch aus Permanentmagneten und muss kein Magnetfeld durch Induktion erzeugen, was den Rotorverlust deutlich reduziert. Gleichzeitig ist der Luftspalt zwischen Stator und Rotor eines Synchronmotors kompakter ausgelegt, wodurch die Magnetfeldausnutzung höher ist. Natürlich ist auch die Effizienz der Umwandlung von elektrischer Energie in Drehmoment höher, in der Regel 5 bis 10 % effizienter als bei herkömmlichen Asynchronmotoren gleicher Leistung.
Die Verfeinerung des Strukturdesigns ist der Schlüssel zur Vergrößerung der Energieeffizienzlücke zwischen Motoren des gleichen Typs. Am Beispiel von Asynchronmotoren kann der Einsatz von Siliziumstahlblechen mit hoher magnetischer Induktion den Kernverlust deutlich reduzieren. Diese Art von Siliziumstahlblech hat eine höhere magnetische Permeabilität, sodass bei Änderungen des Magnetfelds weniger interne Ströme entstehen. Im Vergleich zu gewöhnlichen Siliziumstahlblechen kann der Kernverlust um mehr als 20 % reduziert werden. Auch das Material und das Wickelverfahren der Wickeldrähte wirken sich auf die Energieeffizienz aus. Kupferdrähte haben eine bessere elektrische Leitfähigkeit als Aluminiumdrähte. Wicklungen aus Kupferdrähten haben einen geringeren Widerstand, was zu geringeren „Kupferverlusten“ (Wärmeverlusten, die entstehen, wenn Strom durch den Widerstand fließt) führt, wenn Strom hindurchfließt. Darüber hinaus ermöglicht das präzise Wickelverfahren eine engere Anordnung der Drähte, wodurch der Abstand zwischen den Drähten verringert und die magnetische Feldausnutzung verbessert wird. Im Gegensatz dazu können Motoren mit geringerer Energieeffizienz Aluminiumdrähte verwenden oder grobe Wickelverfahren aufweisen. Allein der Kupferverlust ist 15–20 % höher als bei Motoren mit hoher Energieeffizienz.
Die Anpassungsfähigkeit des Motors an die Betriebsbedingungen wirkt sich auch direkt auf die tatsächliche Energieeffizienz aus. Wechselstrommotoren haben einen „Nennbetriebszustand“ (den optimalen Betriebszustand für den Motor). Entspricht die tatsächliche Last nicht der Nennlast, sinkt die Energieeffizienz deutlich. Läuft beispielsweise ein Asynchronmotor mit einer Nennleistung von 10 kW über längere Zeit mit einer geringen Last von 3 kW, entsteht der Eindruck, als würde man einen kleinen Karren ziehen. In diesem Fall sinkt der Leistungsfaktor des Motors (je niedriger der Leistungsfaktor, desto geringer der Stromverbrauch), der Kernverlust steigt, und die Energieeffizienz kann von 85 % unter Nennbetriebsbedingungen auf unter 60 % sinken. Die Drehzahl eines Synchronmotors ist jedoch lastunabhängig (solange das maximale Drehmoment nicht überschritten wird). Auch bei starken Lastschwankungen kann er einen hohen Leistungsfaktor und eine hohe Energieeffizienz aufrechterhalten. Beispielsweise kann ein Permanentmagnet-Synchronmotor im Antriebssystem von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb seine Leistung flexibel an die Fahrzeuggeschwindigkeit und die Straßenverhältnisse anpassen. Selbst bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Last kann die Energieeffizienz über 80 % gehalten werden, was im gleichen Szenario viel höher ist als bei Asynchronmotoren.
Darüber hinaus wirkt sich eine sinnvolle Wärmeableitung indirekt auf die Energieeffizienz aus. Die während des Motorbetriebs entstehenden Verluste werden in Wärme umgewandelt. Kann die Wärme nicht rechtzeitig abgeführt werden, steigt die Motortemperatur, was wiederum den Wicklungswiderstand erhöht (der Widerstand des Leiters steigt mit steigender Temperatur). Dies wiederum erhöht die Kupferverluste und führt zu einem Teufelskreis aus „Verlust – Temperaturanstieg – weitere Verluste“. Motoren mit hoher Energieeffizienz sind in der Regel mit effizienteren Wärmeableitungsstrukturen ausgestattet, beispielsweise durch vergrößerte Kühlkörperflächen, den Einsatz von Axiallüftern zur forcierten Wärmeableitung und sogar die Installation von Wasserkühlungen bei Hochleistungsmotoren. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass der Motor stets bei angemessener Temperatur arbeitet und eine Verschlechterung der Energieeffizienz durch Überhitzung vermieden wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Unterschied in der Energieeffizienz von Wechselstrommotoren durch die Faktoren „Typmerkmale + Konstruktion + Anpassungsfähigkeit an Betriebsbedingungen + Wärmeableitungskapazität“ bestimmt wird. Synchronmotoren bieten aufgrund fehlender Rotorinduktionsverluste inhärente Vorteile. Das raffinierte Design aus hochmagnetischen Siliziumstahlblechen und Kupferwicklungen reduziert Kernverluste. Die Anpassungsfähigkeit an die Betriebsbedingungen vermeidet Energieeffizienzverluste durch Lastfehlanpassung. Eine angemessene Wärmeableitung verhindert den Teufelskreis der Verluste. Das Verständnis dieser Faktoren kann Unternehmen nicht nur bei der Auswahl energieeffizienterer Motoren helfen, sondern auch die Optimierungsrichtung „Verlustreduzierung und Verbesserung der Anpassungsfähigkeit“ für die Motorenforschung und -entwicklung aufzeigen.