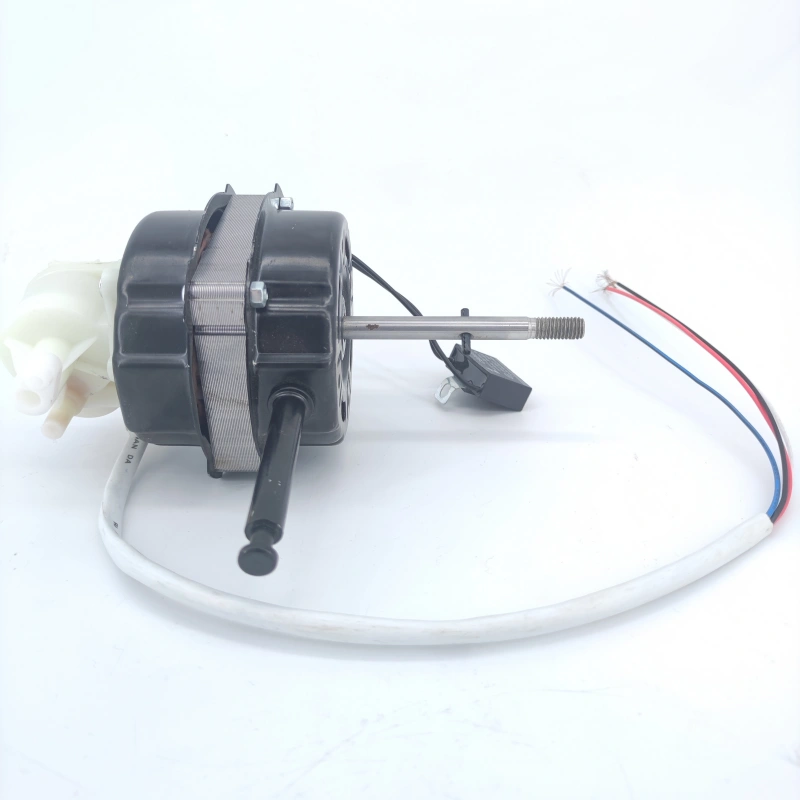In industriellen Antriebssystemen liegt die Beliebtheit von Wechselstrommotoren seit vielen Jahren bei über 80 % und übertrifft damit den Einsatzanteil von Gleichstrommotoren deutlich. Dieses Phänomen ist kein Zufall; es wird durch die strukturellen Eigenschaften, die Betriebskosten, den Wartungsaufwand und die technische Anpassungsfähigkeit der beiden Motortypen gemeinsam bestimmt. Konkret lässt es sich anhand von vier Kerndimensionen analysieren:
Zunächst einmal ist der Zuverlässigkeitsvorteil, der sich durch die vereinfachte Struktur ergibt, eine wichtige Voraussetzung. Wechselstrommotoren (insbesondere Asynchronmotoren) benötigen keine Kommutatoren und Bürsten, die für Gleichstrommotoren unerlässlich sind. Ihre Rotoren bestehen lediglich aus Siliziumstahlblechen und Wicklungen und haben keine mechanischen Kontakt- und Verschleißteile. Diese Konstruktion ermöglicht ihnen einen stabilen Betrieb in rauen Industrieumgebungen wie Staub, Vibrationen und hohen Temperaturen mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von über 10.000 Stunden. Im Gegensatz dazu müssen Gleichstrommotoren aufgrund von Bürstenverschleiß in der Regel alle 2.000 bis 3.000 Stunden abgeschaltet und ausgetauscht werden, was die Kontinuität der Produktionslinie ernsthaft beeinträchtigt. Beispielsweise können Wechselstrommotoren in Walzwerken von Eisen- und Stahlwerken mehrere Monate lang ohne Wartung kontinuierlich laufen, während Gleichstrommotoren früher aufgrund von Bürstenfunkenproblemen häufig abgeschaltet wurden, was zu einer Verringerung der Produktionseffizienz um über 30 % führte.
Zweitens senkt der umfassende Vorteil der Kosten- und Energieeffizienz die Schwelle für industrielle Anwendungen. Was die Herstellungskosten betrifft, ist der Kupfer- und Eisenverbrauch von Wechselstrommotoren 15 bis 20 % niedriger als bei Gleichstrommotoren gleicher Leistung. Zudem benötigen Wechselstrommotoren keine aufwändige Kommutatortechnologie, sodass die Massenproduktionskosten um etwa 25 % gesenkt werden können. In Bezug auf die Betriebsenergieeffizienz erreicht der Nennwirkungsgrad von Drehstrom-Asynchronmotoren in der Regel 90 bis 96 %, und Modelle mit ultrahohem Wirkungsgrad übersteigen sogar 97 %. Aufgrund von Bürstenreibungsverlusten ist der Wirkungsgrad von Gleichstrommotoren jedoch in der Regel 5 bis 8 % niedriger als der von Wechselstrommotoren gleicher Leistung. Am Beispiel eines 100-kW-Motors lässt sich mit einem Wechselstrommotor eine Stromkostenersparnis von etwa 12.000 Yuan pro Jahr erzielen (berechnet auf Grundlage eines Industriestrompreises von 0,6 Yuan/kWh und 8.000 Betriebsstunden pro Jahr), was einen erheblichen Vorteil bei den langfristigen Nutzungskosten darstellt.
Drittens hat der Durchbruch in der Drehzahlregelungstechnologie traditionelle Mängel beseitigt. Früher wurden Wechselstrommotoren in Anwendungsbereichen, die eine präzise Drehzahlregelung erforderten, durch Gleichstrommotoren ersetzt, da eine gleichmäßige Regelung schwierig war. Mit der Entwicklung der Leistungselektronik ermöglichen Frequenzumrichter jedoch eine stufenlose Drehzahlregelung von Wechselstrommotoren von 0 bis 3000 U/min durch Änderung von Frequenz und Spannung des Wechselstroms mit einer Drehzahlregelgenauigkeit von ±0,5 %, was den Steuerungsanforderungen von Geräten wie Werkzeugmaschinen und Förderbändern voll gerecht wird. Gleichstrommotoren hingegen verfügen zwar über eine ausgereifte Drehzahlregelung, benötigen aber komplexe Erregersteuerungen. Bei Hochleistungsanwendungen (z. B. über 1000 kW) sind ihr Volumen und Gewicht deutlich größer als bei Wechselstrommotoren, was Installation, Betrieb und Wartung deutlich aufwändiger macht.
Schließlich haben die Anpassungsfähigkeit und Sicherheit des Stromnetzes die Anwendungsgrundlage gefestigt. Industrielle Stromnetze nutzen in der Regel dreiphasigen Wechselstrom zur Stromversorgung, und Wechselstrommotoren können ohne zusätzliche Gleichrichter direkt an das Stromnetz angeschlossen werden, wodurch Verluste und Fehlerquellen bei der Umwandlung elektrischer Energie reduziert werden. Im Gegensatz dazu müssen Gleichstrommotoren Wechselstrom über Gleichrichter in Gleichstrom umwandeln, was nicht nur die Gerätekosten erhöht, sondern auch Oberschwingungsverschmutzung verursachen und die Stabilität des Stromnetzes beeinträchtigen kann. Darüber hinaus kann der Anlaufstrom von Wechselstrommotoren durch Sanftanlaufgeräte auf das 2- bis 3-fache des Nennstroms geregelt werden, wodurch Auswirkungen auf das Stromnetz vermieden werden. Der direkte Anlaufstrom von Gleichstrommotoren kann jedoch das 5- bis 8-fache des Nennwerts erreichen, was wahrscheinlich zu Spannungsschwankungen im Stromnetz führt und den Betrieb anderer Geräte beeinträchtigt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wechselstrommotoren aufgrund ihrer umfassenden Vorteile hinsichtlich Zuverlässigkeit, Kosten, Drehzahlregelung und Netzanpassbarkeit die bevorzugte Antriebstechnologie in der industriellen Produktion darstellen. Gleichstrommotoren hingegen sind meist auf Spezialanwendungen beschränkt, die eine extrem hohe Drehzahlregelungsgenauigkeit erfordern und über eine geringe Leistung verfügen (z. B. Präzisionsinstrumente und kleine Roboter). Mit der Entwicklung neuer Wechselstrommotortechnologien, wie beispielsweise Permanentmagnet-Synchronmotoren, wird sich ihr Anwendungsbereich weiter erweitern und die industrielle Automatisierung kontinuierlich verbessern.