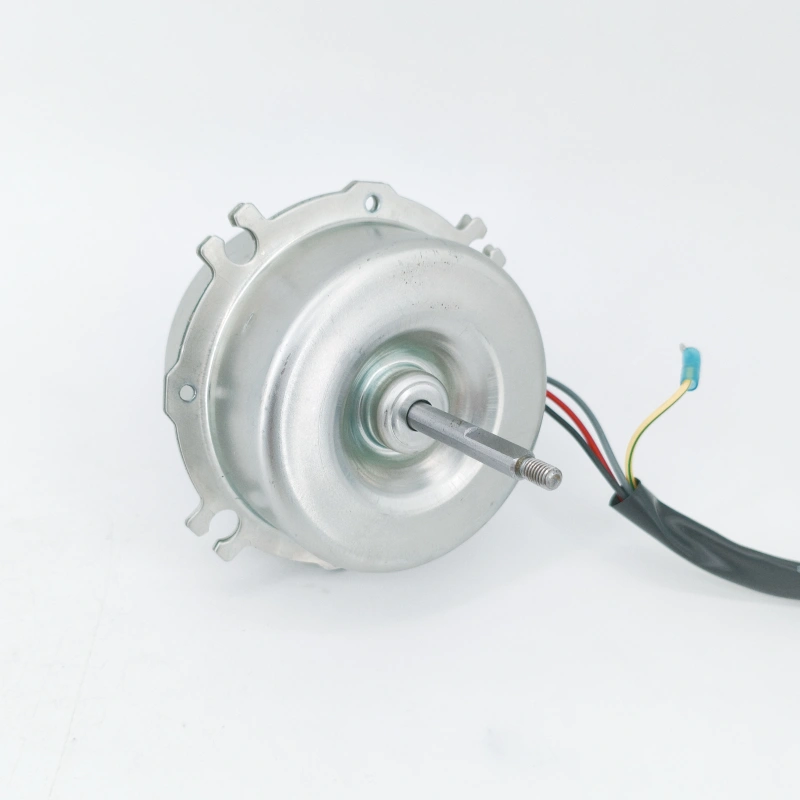Wechselstrommotoren werden aufgrund ihrer Vorteile wie einfacher Aufbau, hohe Zuverlässigkeit und niedrige Kosten häufig in der industriellen Produktion, bei Haushaltsgeräten und in anderen Bereichen eingesetzt. Die Drehzahl wird durch die Netzfrequenz, die Anzahl der Motorpole und die Schlupfrate beeinflusst (Formel: n = 60f/p (1-s), wobei n die Drehzahl, f die Netzfrequenz, p die Anzahl der Pole und s die Schlupfrate ist). Basierend auf diesem Prinzip lassen sich gängige Drehzahlregelungsmethoden in die folgenden Kategorien einteilen:
1. Steuerungsmethode basierend auf der Leistungsfrequenzregelung: Drehzahlregelung mit variabler Frequenz
Die Drehzahlregelung mit variabler Frequenz ist derzeit die am weitesten verbreitete und präziseste Steuerungsmethode zur Drehzahlregelung von Wechselstrommotoren. Der Kern besteht darin, eine präzise Drehzahleinstellung durch Änderung der Netzfrequenz des Eingangsmotors zu erreichen.
Funktionsprinzip: Mithilfe eines Frequenzumrichters wird Wechselstrom (z. B. 220 V/50 Hz, 380 V/50 Hz) in Wechselstrom mit einstellbarer Frequenz umgewandelt, wobei die Spannung an die Eigenschaften des Motors angepasst wird (normalerweise nach dem Prinzip des „konstanten Spannungs-/Frequenzverhältnisses“, um eine Sättigung des Motormagnetkreises zu vermeiden), wodurch die Synchrondrehzahl des Motors geändert wird.
Merkmale: Großer Drehzahlbereich (Betrieb von 0 bis Nenndrehzahl oder sogar darüber hinaus möglich), hohe Genauigkeit (Drehzahlfehler können innerhalb von 0,5 % kontrolliert werden), geringer Energieverbrauch (Motorwirkungsgrad bleibt auch bei Betrieb mit niedriger Drehzahl hoch) und kein Stoßstrom während des Anlaufs, wodurch Motor und Lastausrüstung wirksam geschützt werden.
2. Steuerungsmethode basierend auf der Einstellung der Motorpolzahl: variable Poldrehzahlregelung
Die variable Poldrehzahlregelung ist eine abgestufte Drehzahlregelungsmethode, bei der die Anzahl der Magnetpole (p) eines Motors durch Änderung der Verbindung seiner Statorwicklung angepasst und dadurch die Synchrondrehzahl geändert wird.
Funktionsprinzip: Die Statorwicklung des Motors verfügt über eine spezielle Abgriff- oder Schaltstruktur und die Wicklungsverbindungsmethode wird durch einen Schütz umgeschaltet (z. B. Stern-/Dreieckstransformation, Doppelstern-/Dreieckstransformation), sodass sich die Anzahl der Magnetpole exponentiell ändert (z. B. von 2 Polen auf 4 Pole) und die Synchrondrehzahl entsprechend um die Hälfte sinkt (z. B. von 3000 U/min auf 1500 U/min bei einer Netzfrequenz von 50 Hz).
Merkmale: Einfache Struktur, niedrige Kosten, einfache Bedienung, grundsätzlich unveränderte Motoreffizienz während der Drehzahlregelung, aber begrenzte Drehzahlregelungsstufen (normalerweise nur 2–3 Drehzahlregelungsstufen, z. B. 2-polige/4-polige/6-polige Umschaltung), keine kontinuierliche Drehzahlregelung möglich und kann im Moment der Umschaltung zu Drehzahlstößen führen.
3. Steuermethode basierend auf Schlupfeinstellung
Die Schlupfrate (s) ist das Verhältnis der Differenz zwischen der tatsächlichen Motordrehzahl und der Synchrondrehzahl zur Synchrondrehzahl. Durch Änderung der Schlupfrate kann eine Drehzahlregelung des Wechselstrommotors erreicht werden. Gängige Methoden sind die Drehzahlregelung mit Reihenwiderstand, die Drehzahlregelung mit Reihenstufe und die Drehzahlregelung mit Spannungsregelung.
Drehzahlregelung durch Reihenwiderstand (gilt nur für Asynchronmotoren mit gewickeltem Rotor)
Funktionsprinzip: Im Rotorkreis eines Asynchronmotors mit gewickeltem Rotor ist ein einstellbarer Widerstand in Reihe geschaltet. Durch Erhöhen des Widerstandswerts wird der Schlupf erhöht und die tatsächliche Motordrehzahl reduziert (je höher der Widerstand, desto niedriger die Drehzahl).
Merkmale: Einfache Struktur, niedrige Kosten, aber hoher Energieverbrauch (der Serienwiderstand erzeugt eine große Menge Joule-Wärme, was zu erheblichen Energieverlusten führt), geringe Genauigkeit der Drehzahlregelung (die Drehzahl schwankt stark bei Laständerungen) und erhebliche Abnahme der Motoreffizienz bei Betrieb mit niedriger Drehzahl.