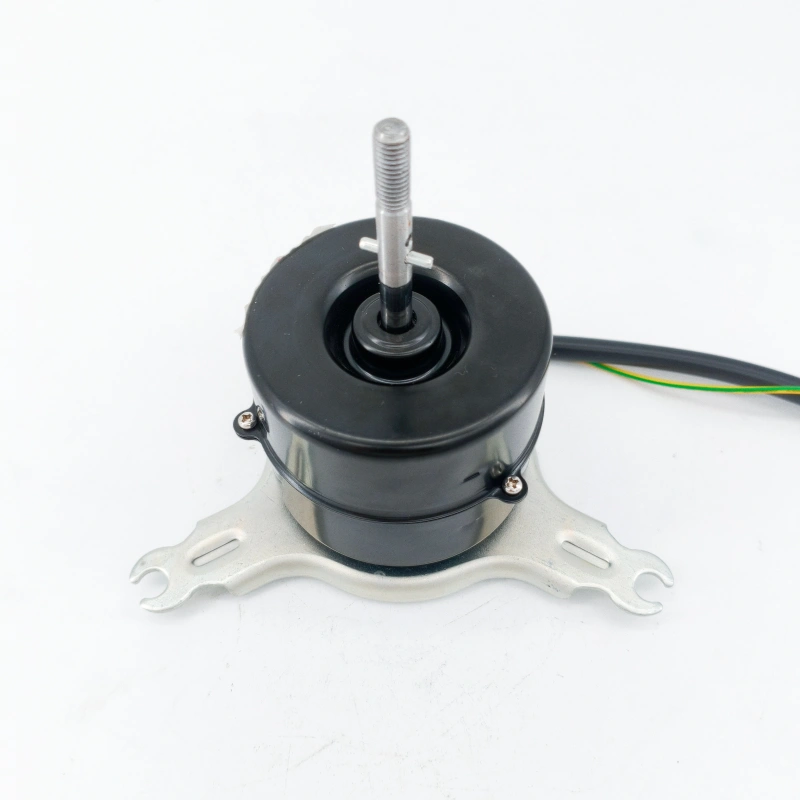Die Drehzahlstabilität eines Gleichstrommotors bestimmt maßgeblich seinen Anwendungswert. Insbesondere in Bereichen wie der Präzisionsfertigung und der automatisierten Fördertechnik führen Drehzahlschwankungen häufig zu Kettenproblemen. Um dieses Problem zu beheben, ist es notwendig, von den strukturellen Eigenschaften und dem Funktionsprinzip des Motors auszugehen, eine umfassende Analyse in Verbindung mit der elektrischen Steuerung und den mechanischen Übertragungssystemen durchzuführen, die Kernursache zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.
I. Hauptursachen von Geschwindigkeitsschwankungen
Die Drehzahlformel eines Gleichstrommotors lautet n = (U – IaRa) / (CeΦ) (wobei n die Drehzahl, U die Ankerspannung, Ia der Ankerstrom, Ra der Ankerwiderstand, Ce die Gegen-EMK-Konstante und Φ der Erregerfluss ist). Die Instabilität eines beliebigen Parameters in der Formel verursacht Drehzahlschwankungen, die sich in drei Kategorien einteilen lassen.
1. Anomales elektrisches System: Direkter Auslöser von Parameterschwankungen
Eine instabile Ankerstromversorgung ist die häufigste Ursache. Beispielsweise führen übermäßige Restwelligkeit der Gleichstromversorgung, schlechter Drahtkontakt oder plötzliche Spannungsabfälle aufgrund unzureichenden Drahtdurchmessers zu anormalen Schwankungen des U-Wertes in der Formel. Fehler im Erregerkreis sind ebenfalls entscheidend. Bei einem reihenerregten Motor ist die Erregerwicklung in Reihe mit dem Anker geschaltet. Bei einem Teilschluss in der Wicklung sinkt Φ, was einen plötzlichen Drehzahlanstieg zur Folge hat. Bei einem nebenerregten Motor verursacht ein schlechter Kontakt des Erregerwiderstands Änderungen des Erregerstroms und damit Schwankungen von Φ. Darüber hinaus führen Windungsschlüsse in der Ankerwicklung oder Oxidation der Kommutatorsegmente zu kurzzeitigen Änderungen von Ia. Der über Ra erzeugte Spannungsabfall ändert sich entsprechend, wodurch der Drehzahlausgleich gestört wird.
2. Probleme der mechanischen Struktur: Störfaktoren bei der Kraftübertragung
Die Verbindungsmethode zwischen Motor und Last beeinflusst die Drehzahlstabilität direkt. Fehlausrichtungen in der Kupplungsmontage (z. B. durch falsche Ausrichtung oder Lockerung) verursachen periodische Schwankungen des Lastmoments und damit starke Schwankungen des Ansprechmoments Ia bei Laständerungen. Lagerverschleiß oder mangelhafte Schmierung erhöhen den mechanischen Reibungswiderstand; die zufällige Änderung dieses Widerstands stört das Gleichgewicht von „elektromagnetischem Drehmoment = Lastmoment + Reibungsmoment“ und verursacht Drehzahlschwankungen. Bei einer Unwucht des Rotors erzeugt die bei hohen Drehzahlen entstehende Zentrifugalkraft mechanische Vibrationen, die die Drehmomentschwankungen zusätzlich verstärken.
3. Steuerungs- und Umweltfaktoren: Systemregelung und externe Störungen
Eine wichtige Ursache sind nicht übereinstimmende Parameter des Drehzahlregelungssystems. Beispielsweise führt ein zu hoher Proportionalbeiwert des PID-Reglers leicht zu Überschwingen, und eine zu lange Integrationszeit verhindert eine rechtzeitige Unterdrückung von stationären Fehlern, wodurch die Drehzahl um den Sollwert oszilliert. Auch äußere Umwelteinflüsse dürfen nicht vernachlässigt werden: Starke elektromagnetische Strahlung stört die Steuersignale, und Temperaturänderungen beeinflussen die Widerstandswerte von Ra und der Erregerwicklung. Steigt die Temperatur, erhöht sich Ra; bleibt U unverändert, sinken Ia und das elektromagnetische Drehmoment, was letztendlich zu einem Drehzahlabfall führt.
II. Systematische Lösungen
1. Optimierung des elektrischen Systems zur Stabilisierung der Kernparameter
Überprüfen Sie zunächst das Stromversorgungssystem: Ersetzen Sie das Gleichstromnetzteil durch ein hochwertiges (Welligkeitsfaktor ≤ 1 %) oder schließen Sie einen Kondensator parallel zum Ausgangsanschluss zur Filterung an. Bei Problemen mit der Verkabelung ist sicherzustellen, dass der Kabelquerschnitt den Stromanforderungen entspricht (Stromdichte ≤ 6 A/mm²). Ziehen Sie die Klemmenblöcke nach und verwenden Sie gegebenenfalls versilberte Kontakte, um den Kontaktwiderstand zu reduzieren. Überprüfen Sie anschließend die Wicklungen: Prüfen Sie die Isolation der Anker- und Erregerwicklungen mit einem Megohmmeter. Bei einem Kurzschluss wickeln Sie die Wicklungen neu und achten Sie auf die Wicklungsgenauigkeit (Windungszahl ≤ 0,5 %). Polieren Sie oxidierte Kommutatorsegmente mit feinem Schleifpapier und tragen Sie leitfähiges Fett auf. Prüfen Sie gleichzeitig die Kontaktfläche zwischen Bürste und Kommutatorsegmenten; diese muss mindestens 85 % betragen.
2. Reparieren Sie die mechanische Struktur, um Übertragungsstörungen zu beseitigen.
Bei Verbindungsproblemen ist die Kupplung neu zu kalibrieren, um sicherzustellen, dass der Radialschlag ≤ 0,05 mm und der Stirnflächenschlag ≤ 0,03 mm beträgt. Bei starken Lastschwankungen kann eine flexible Kupplung zur Stoßdämpfung eingesetzt werden. Bei Lagerschäden sind hochpräzise Lager desselben Typs (z. B. Güteklasse P5) zeitnah auszutauschen und regelmäßig hochtemperaturbeständiges Fett nachzufüllen (alle 500 Betriebsstunden). Bei Unwucht des Rotors ist eine dynamische Auswuchtprüfung durchzuführen und die Unwucht durch Anbringen von Auswuchtgewichten an beiden Rotorenden auf unter 5 g·cm zu reduzieren.
3. Verbesserung der Kontrollstrategien zur Isolierung externer Störungen
Die PID-Parameter sollten neu eingestellt und die optimalen Parameter durch Sprungantworttests ermittelt werden: Der Proportionalkoeffizient gewährleistet die geforderte Ansprechgeschwindigkeit, die Integrationszeit eliminiert statische Fehler und die Ableitungszeit unterdrückt Überschwingen. Zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen kann die Steuerschaltung mit einer Metallabschirmung versehen werden, die an einem einzigen Punkt geerdet werden sollte. Um den Temperatureinfluss zu kompensieren, sollte ein Temperatursensor am Motor installiert und die Ankerspannung über das Steuerungssystem temperaturkompensiert werden – bei einem Temperaturanstieg von 10 °C wird die Ankerspannung automatisch um 1–2 % erhöht. Zusätzlich sollte der Motor regelmäßig gewartet, von Staub befreit und das Kühlsystem überprüft werden, um einen Betrieb im Temperaturbereich von 40–60 °C zu gewährleisten.
Durch die oben genannten systematischen Maßnahmen in den Bereichen Elektrik, Mechanik und Steuerungstechnik lässt sich das Problem der Drehzahlschwankungen von Gleichstrommotoren effektiv lösen. Die Drehzahlschwankungen können auf ±1 % begrenzt werden, wodurch die Anforderungen an einen präzisen Betrieb erfüllt und die Lebensdauer des Motors um mehr als 30 % verlängert wird.